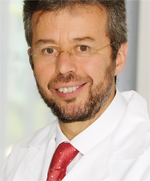Wir hat Ihre Karriere begonnen?
Ich habe in Wien Medizin studiert, war dann am Institut für Physiologie und habe dort einige Monate geforscht und dann relativ rasch den Facharzt für innere Medizin gemacht. Dann war ich Assistent an der damaligen 2. Medizinischen Universitätsklinik und habe mich forschungsmäßig auf Atherosklerose-Forschung und Diabetologie konzentriert. Zwischendurch hatte ich einen mehrmonatigen Aufenthalt in London. Dann habe ich ein Stipendium bekommen und bin von 1988 bis 1990 nach Amerika gegangen, nach Charleston in South Carolina, wo damals die Spitzenforschung zum Thema Immunmechanismen bei der Atherosklerose stattfand. Kurz vor der Eröffnung des neuen AKH bin ich zurückgekommen und dann im Zuge verschiedenster Umstrukturierungen als breit aufgestellter Internist in die internistische Rheumatologie gewechselt, wo ich relativ rasch stellvertretender Leiter der Rheumatologischen Abteilung wurde. Als mein Chef ausgeschieden ist und sich das Berufungsverfahren für den neuen Leiter, das üblicherweise ein halbes Jahr dauert, aufgrund verschiedener Gründe mehrere Jahre hingezogen hat, habe ich während dieser Zeit die Abteilung interimistisch geleitet, mit 20-60 Mitarbeitern, je nachdem ob man das Pflegepersonal dazu zählt oder nicht. Die Kombination Forschung, Lehre und Management hat mich immer schon sehr interessiert.
Wie waren Ihre ersten Erfahrungen im medizinischen Betrieb?
Nicht sehr überraschend, weil ich schon vorher Einblicke ins System hatte, da mein Vater auch Arzt war, zuerst in der Klinik, dann als Spitzenbeamter im Gesundheitsministerium. Während meiner Studienzeit war ich in der Hochschülerschaft und jahrelang Vorsitzender der Fakultätsvertretung Medizin, Fachschaftsleiter, Mandatar im Hauptauschuss und Präsident der AMSA, der Austrian-Medical-Students-Association. Da habe ich bereits sehr viel von dieser komplexen Organisation Universität mit den Inkompatibilitäten zwischen zwei Trägern, Bund und Land, mitbekommen.
Was lernt man da über Management?
Durch die ÖH-Tätigkeit habe ich persönlich unglaublich viel gelernt. Mehr als durch Kurse und Ausbildungen, die ich später gemacht habe. Die Erfahrung als Studentenvertreter will ich nicht missen. Ich bin da eher hineingestolpert: Man braucht gerade jemanden für eine bestimmte Aufgabe, wird gefragt und plötzlich ist man Chef der Fakultätsvertretung Medizin oder Mandatar. Da gibt es keinen Wettbewerb, wo man sich durchkämpfen müsste, sondern im Gegenteil, wenn man Interesse signalisiert, bekommt man sehr schnell eine Verantwortung übertragen. Ich war damals 20 Jahre alt und meine Sekretärin, eine promovierte Historikerin, war 50. Man lernt dabei vor allem Führen, denn die meisten Mitarbeiter machen das mehr oder weniger gratis. Also muss man Menschen dazu bringen, Ziele zu erreichen und sich dafür Zeit vom Studium abzuzwacken, ohne dass sie dafür finanziell belohnt werden und ohne dass man Sanktionsmöglichkeiten hat. Ich würde jedem raten, in diesem Alter solche Aufgaben zu übernehmen, das hilft einem später sehr viel. Klar ist aber auch, dass man dafür gewisse Opfer bringt, denn das kostet viel Zeit.
Wovon hängt es ab, ob dieses Führen der Freiwilligen gut funktioniert?
Man braucht irgendein Projekt, eine Vision, eine Idee, um die Gruppe auf irgendetwas hin auszurichten. Man braucht eine Agenda, ein Ziel. Dann geht es darum, die Leute nach ihren Stärken richtig einzusetzen und zu schauen, dass sie dafür – zumindest auf der psychologischen Ebene - irgendeine Art von Belohnung bekommen. Das ist von Person zu Person verschieden und daher müssen Sie sehr individuell auf die verschiedenen Charaktere eingehen. Für mich galt auch später immer das Motto: Man muss sich bemühen, auf Eigenheiten einzugehen und die Stärken zu stärken. Aber genauso gilt: Diejenigen, die destruktiv sind oder intrigieren, muss man ausschließen, egal ob in einer Gruppe oder in einem Betrieb, weil man sonst auf Dauer enorme Reibungsverluste hat. Gerade weil das immer nur eine kleine Minderheit ist, ist es umso wichtiger, dass diese Personen sehen, dass sie mit ihrer destruktiven Art nicht weiterkommen.
Nach Ihrer Rückkehr vom Forschungsaufenthalt im Amerika sind Sie schnell in eine Führungsposition gekommen, oder?
Nicht sofort. Zuerst war ich Assistenzarzt, dann wurde ich Oberarzt. Als interimistischer Leiter kam mir sicher zugute, dass ich schon von Kindheit an mitbekommen habe, dass man Verantwortung übernehmen und gestalten soll. Die organisatorischen und administrativen Tätigkeiten, die zur Leitung dazugehören, habe ich nie als belastend empfunden. Wenn man das nicht will, soll man es nicht machen, insofern habe ich kein Verständnis für Führungskräfte, die sich über Sitzungen und Administration beklagen, denn es gehört zur Führung einfach dazu, dass man kommuniziert, Dinge abstimmt und Aufgaben und Arbeit richtig portioniert und delegiert. Der Fehler, den ich damals nachträglich betrachtet gemacht habe, war der, dass ich – obwohl ich überzeugt war, die Leitung nur für einige Monate zu übernehmen – es trotzdem so anlegen hätte sollen, als würde ich die Aufgabe auf Dauer übernehmen. Ich habe mich da wohl zu sehr zurückgenommen, sozusagen als Statthalter des Übergangs verstanden. Ich hätte viel mehr gestalten können als ich tatsächlich gemacht habe.
Was wäre anders gewesen?
Meine Haupttätigkeit während dieser Zeit war, darauf zu achten, dass der Betrieb ohne Probleme weiterläuft. In der Zeit sind einige Leute alters- und karrieremäßig ausgeschieden und die habe ich auch nachbesetzt, aber ich habe in dieser Zeit keine neuen Initiativen und Schwerpunkte gesetzt. Z.B. kein neues Forschungsfeld definiert oder bestimmte Schwerpunkte beendet. Ich habe eigentlich viel zu wenige Weichenstellungen vorgenommen.
Wie haben die Mitarbeiter auf Sie als Chef reagiert?
Ich war zwar jung, aber doch von den Ärzten der Dienstälteste, wenn auch nur geringfügig. Und der, dem man die Aufgabe am ehesten zugetraut hat. Da spielen durchaus die Vorerfahrungen in der Hochschülerschaft eine Rolle, denn es ging ja auch darum, die Interessen der Abteilung gegenüber anderen Organisationseinheiten und gegenüber der Spitalsdirektion wahrzunehmen. Es war damals die Phase der Übersiedlung und da ging es verstärkt um Raumfragen, Organisationsfragen, Ressourcenverteilung. Es gab damals vier Universitätsklinken für innere Medizin mit insgesamt 300 Ärzten und jede Klinik war wiederum in drei Abteilungen gegliedert. In meiner Klinik waren die Rheumatologie, die Endokrinologie (Hormonerkrankungen) und die Nephrologie (Nierenerkrankungen). Und jede Abteilung hatte einen Abteilungsleiter mit der Funktion eines Primararztes, nur heißt das an der Universität eben Abteilungsleiter. Einer aus dem Kreis der drei Abteilungsleiter wurde dann immer für zwei Jahre Klinikvorstand, allerdings war das eine eher symbolische Macht mit wenig operativen Kompetenzen.
Ist man im medizinischen Betrieb nicht ständig im Clinch um Ressourcen?
Konflikt muss man als etwas Normales begreifen, man muss nur klar unterscheiden, um welche Art von Konflikt es sich handelt. Ressourcenkonflikte sind etwas völlig Normales, denn Ressourcen sind immer begrenzt. Ein Ressourcenkonflikt tritt immer dann auf, wenn die Phantasie größer ist als die vorhandenen Ressourcen. Ich sage immer: "Wenn es keinen Ressourcenkonflikt gibt, dann hat man einfach zu wenig Phantasie." Insofern geht es bei sich daraus ergebenden Machtkämpfen vor allem darum, als Führungskraft die richtigen Spielregeln zu entwickeln, um Ressourcenkonflikte für das Gesamtziel gut auszutragen. Es muss eine transparente, nachvollziehbare Logik der Entscheidungsprozesse geben. Es braucht Kriterien, nach denen diese Ressourcenkonflikte entschieden werden. Etwas ganz anderes sind strategische Konflikte, die es auch gibt – was ist eigentlich die Aufgabe meiner Organisation, meiner Firma, wie sind die Prioritäten? Diese Konflikte kann man nur dialektisch lösen, indem es so etwas wie eine Diskussionskultur gibt. Da gibt es nicht immer nur "wahr" oder "falsch".
Ist in einer Organisation mit so vielen Kollegialorganen so etwas wie eine klare Entscheidungsstruktur überhaupt möglich?
Natürlich gibt es da Frustrationen, aber man kann auch in so einem Umfeld mehr entscheiden als viele glauben. Das dient oft nur als Ausrede. Meine Erfahrung ist, dass sich viele "Akteure" eigentlich vor Entscheidungen drücken. Man kann viel bewegen, indem man einfach agiert, man muss sich nur trauen. Oft werden Entscheidungen in solchen Biotopen -wie dem medizinischen Betrieb - dadurch verzögert oder verhindert, dass jeder so viel Angst vor Management-Fehlern oder einer Niederlage hat, dass er sich dann überhaupt nichts mehr traut. Im Krankenhaus geht es z.B.: um Entscheidungen wie: Mache ich eine neue Ambulanz auf oder nicht? Schließe ich ein Labor oder nicht? Versetze ich eine Person von der Station in die Ambulanz oder nicht? Genehmige ich jemandem einen Urlaub oder nicht? Das sind keine großartigen Entscheidungen. Natürlich war alles, was damals an der Klinik in Richtung strategische Entscheidungen ging, Gremien-lastig. In dem Fall muss man sich halt überlegen, wie Gremien funktionieren. Es geht ja bei Führung nicht nur darum, wie ich Mitarbeiter führe, sondern auch darum, dass ich Gremien oder Vorgesetzte führe. Führen geschieht auf allen Ebenen und in alle Richtungen. Natürlich wird es komplexer, wenn bestimmte Gremial- Beschlüsse notwendig sind. Dann muss ich mir eben passende Strategien und Taktiken zurechtlegen.
Und wie erhöhe ich da meine Erfolgschancen?
Gremien bestehen aus Personen. Also muss ich mir überlegen, mit welchen Motivationen und Interessen wer wie handelt. Ich muss die "Mechanik" der Akteure im Gremium zu verstehen versuchen, denn wenn ich verstehe, warum jemand so oder so agiert, habe ich auch die Chance, gewisse Ansatzpunkte zu finden, um die Ziele durchzusetzen, die ich erreichen möchte. Einfach ist es, wenn die Akteure rationale Interessen haben: Der eine will etwas Bestimmtes für seine Organisationseinheit, dem anderen geht es vielleicht vorrangig um Sichtbarwerden und Ruhm, etc. Wenn ich das weiß, dann kann ich diese Person möglicherweise auf meine Seite bringen, wenn sie auf einem Kongress ein Eröffnungsstatement halten kann oder prominent auf irgendeiner Ankündigung steht. Natürlich sind Leute nicht gewinnbar, wenn es ein Nullsummenspiel ist, wenn es also objektiv so ist, dass meine Interessen nur auf Kosten der Interessen einer anderen Person verwirklichbar sind, das ist dann ein reines Muskelspiel. Allerdings sind viele Nullsummenspiele nur vermeintliche Nullsummenspiele. Damit meine ich: Wenn ich z.B. ein Wirtshaus habe und neben mir eröffnet ein neues Wirtshaus, dann kann ich das als Nullsummenspiel betrachten und den anderen bekämpfen. Ich kann aber auch gemeinsam versuchen, aus der Strasse eine Lokalmeile zu machen, deren einzelne Lokale gut aufeinander abgestimmt sind. Das könnte allen zugute kommen. Dazu braucht es aber Phantasie, um zu überlegen, wie man die Situation umformen kann, damit beide davon profitieren. Übrigens: dies wurde ja vor 30 Jahren in Wien dann tatsächlich als "Bermuda Dreieck" verwirklicht.
Wie kam es zum Wechsel vom AKH ins Haus der Barmherzigkeit?
Ende der 90er-Jahre gab es einen Skandal im Haus der Barmherzigkeit, durch den transparent wurde, dass das ganze Haus in einem desolaten Zustand war. Man brauchte eine Person, die in der Lage ist, die medizinische Leitung zu übernehmen und darüber hinaus auch strategische Fähigkeiten einbringen kann. Es gab bestimmte Anforderungen, nur eine Hand voll Leute, die dafür in Frage gekommen sind und da ich als guter Organisator und als respektierte Führungsperson galt und die richtigen fachlichen Voraussetzungen hatte, ist man an mich herangetreten. Ich habe das als meine Chance begriffen, wirklich nachhaltig eine Organisation gestalten zu können. Es ging mir im Grunde gut im AKH, aber unter den eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten habe ich doch etwas gelitten.
Aber das Ganze war nicht gerade risikolos.
Jein. Der Skandal war traurig, das Haus war baulich desolat, es gab eine zerstrittene Belegschaft und es gab keine Strategie. Aber wenn selbst bei so schlechten Rahmenbedingungen ein Organismus – oder eine Organisation - trotzdem existiert, muss er auch Stärken haben, sonst wäre er schon lange tot. Für mich war interessant: Warum lebt das "Ding" eigentlich noch? Und tatsächlich waren ja Stärken vorhanden: eine unbedingte Kunden- bzw. Bewohner- bzw. Patientenorientierung der Menschen, die hier arbeiten. Diese hingebungsvolle Arbeit mit Menschen, die von der herkömmlichen Medizin sonst oft nur als die "Mißerfolgsgeschichten" wahrgenommen werden. Als "cool" und "sexy" gilt ja üblicherweise die "high-tech"-Medizin: Gliedmaßen wieder annähen, transplantieren, etc. Im Haus der Barmherzigkeit geht es um chronisch schwer kranke Menschen, die von der Medizin sonst ziemlich ausgeblendet sind: chronisch kranke, behinderte Menschen, "Pflegefälle", Geriatrie. Trotz all der zuvor geschilderten schlechten Rahmenbedingungen bewunderte ich die Arbeit der Mitarbeiter, die sich voller Hingabe dieser Aufgabe widmeten. Die organisatorischen Missstände hatten auch ihr Gutes, sie waren quasi die "Lizenz zum Verändern".
Am Beginn stand die Frage: Entweder man findet eine Vision und Strategie für eine vollkommene Erneuerung und einen Umbau der Organisation oder man sperrt zu. Für mich war klar: So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Als pragmatisierter a.o. Professor war ich damals karenziert, also hatte ich auch die Freiheit, diesen neuen Weg zu suchen. Dafür haben wir 1,5 Jahre gebraucht. Dann war verkürzt gesagt klar: Wir wollen die beste Geriatrie bzw. die beste "interdisziplinäre Langzeitbetreuung" der Welt machen. Diese umfasst neben der Geriatrie auch Behindertenbetreuung und andere chronische Krankheiten. Dafür haben mich zwar viele ausgelacht, aber ich fand das ein realistisches Ziel. Denn erstens kann das nur in Amerika oder in Europa entwickelt werden, zweitens ist Europa im Vergleich in diesem Bereich besser, und drittens bleiben innerhalb Europas auch nur eine Handvoll Länder übrig. Das war also durchaus ein realistisches Ziel und selbst wenn man dann am Schluss doch nicht die beste Geriatrie ist, sondern nur Zweiter oder Dritter wird, man muss trotzdem immer "die Goldmedaille anstreben".
Ist das Haus nun ein Altersheim mit besonderer medizinischer Betreuung oder ein Krankenhaus?
Es ist im Grunde genommen ein Krankenhaus für chronisch kranke Menschen, intern ähnlich wie ein Krankenhaus organisiert, mit ähnlicher Personalstruktur, aber in Relation weniger Ärzten als in einem normalen Krankenhaus. Bezüglich der Finanzierung folgt es jedoch der Logik von Pflegeheimen. Es ist also ein Zwischending. Die normalen Strukturen im Gesundheitssystem zielen ab auf: akut krank, medizinisch hochaufwändige Behandlung, begrenzte Behandlungszeit – sprich Akutkrankenhaus. Oder aber: langfristig krank, nicht sehr viel Medizin, wenig Aufwand und langfristige Behandlung. Die Entwicklung der Krankheiten und der Medizin bringen es aber mit sich, dass es auch schwerste chronische Krankheiten gibt, die lange dauern. Länger als einige Tage oder Wochen. Und dafür gibt es keine herkömmlichen Strukturen und Finanzierungen. Diese Lücke schließen wir mit unserem Konzept, ähnlich wären auch viele der sogenannten "medikalisierten" Pflegeheime der Stadt Wien. Auch in den Bundesländern gibt es vereinzelt vergleichbare Strukturen.
Bisher war es so, dass diese "Langzeit- medikalisierten" Pflegeeinrichtungen oder chronischen Krankenhäuser von der Betreuungsstruktur her durchaus gut waren, aber zum Teil äußerst schlechte Wohnqualität für ihre Langzeitpatienten hatten, weil man bei den Spitalsbauten die Aufmerksamkeit immer auf die Akutbereiche gelegt hat. Ob ich in einem Ein-, Zwei- oder Dreibettzimmer liege, wenn ich nur wenige Tage im Krankenhaus liege, ist nicht so wichtig. Bei den chronisch Kranken aber sehr wohl, doch dort wurde die Individualität häufig auf ein Bett und ein Nachtkästchen reduziert. Ein falsches Denken. Wir wollten Betreuungsqualität mit Wohnqualität, daher haben wir hier nur mehr Ein- und Zweibettzimmer. Das dritte Merkmal dieses Konzeptes ist die Integration des Hauses in ein Wohnumfeld. Es sollte also nicht auf dem Gelände eines großen Spitals sein, sondern eingebettet in ein Wohnviertel, ins normale Leben. Inzwischen haben wir alle unsere Einrichtungen neu gebaut und im Grunde ist dieses Haus im 16. Bezirk der Prototyp für alle neuen Projekte der Stadt Wien.
Was unterscheidet Ihre Aufgabe heute von vor zehn Jahren?
Wir sind komplexer geworden und heute ungefähr doppelt so groß als vor 10 Jahren, mit inzwischen ca. 1000 Mitarbeitern und ca. 1000 Personen, die wir betreuen. Wir haben derzeit vier Häuser und insgesamt 18 Standorte, wenn man alle kleinen Wohngemeinschaften unserer Behinderteneinrichtungen mitzählt. Ich habe viel Energie dafür aufgewendet, die besten Leute als Mitarbeiter zu gewinnen. Der Fehler vieler Führungskräfte ist, dass sie sich aus Angst, dass ihnen gute Mitarbeiter gefährlich werden könnten, mit mittelmäßigen Leuten zufrieden geben. Das ist aber komplett falsch! Gefährlich werden mittelmäßige oder nicht so gute Mitarbeiter, weil man dann die Ziele der Organisation langfristig nicht erreichen wird. Wirklich gute Mitarbeiter kommen wegen einer Aufgabe, nicht wegen des Geldes oder des Status. Als übergeordnete Führungskraft ist es mein Job – was nicht immer einfach ist – die Ziele der Organisation so zu gliedern, dass daraus Aufgaben für solche Talente entstehen, die mit den Biographien und Perspektiven der Mitarbeiter zusammenpassen. Aber meine Rolle ist heute sicher eine andere als vor zehn Jahren: Inzwischen entspricht meine Aufgabe der eines strategischen Geschäftsführers oder eines Holdinggeschäftsführers.
© Leaders Circle | Tel.: +43 (1) 513 47 97 | office@leaders-circle.at| Homepage: www.leaders-circle.at